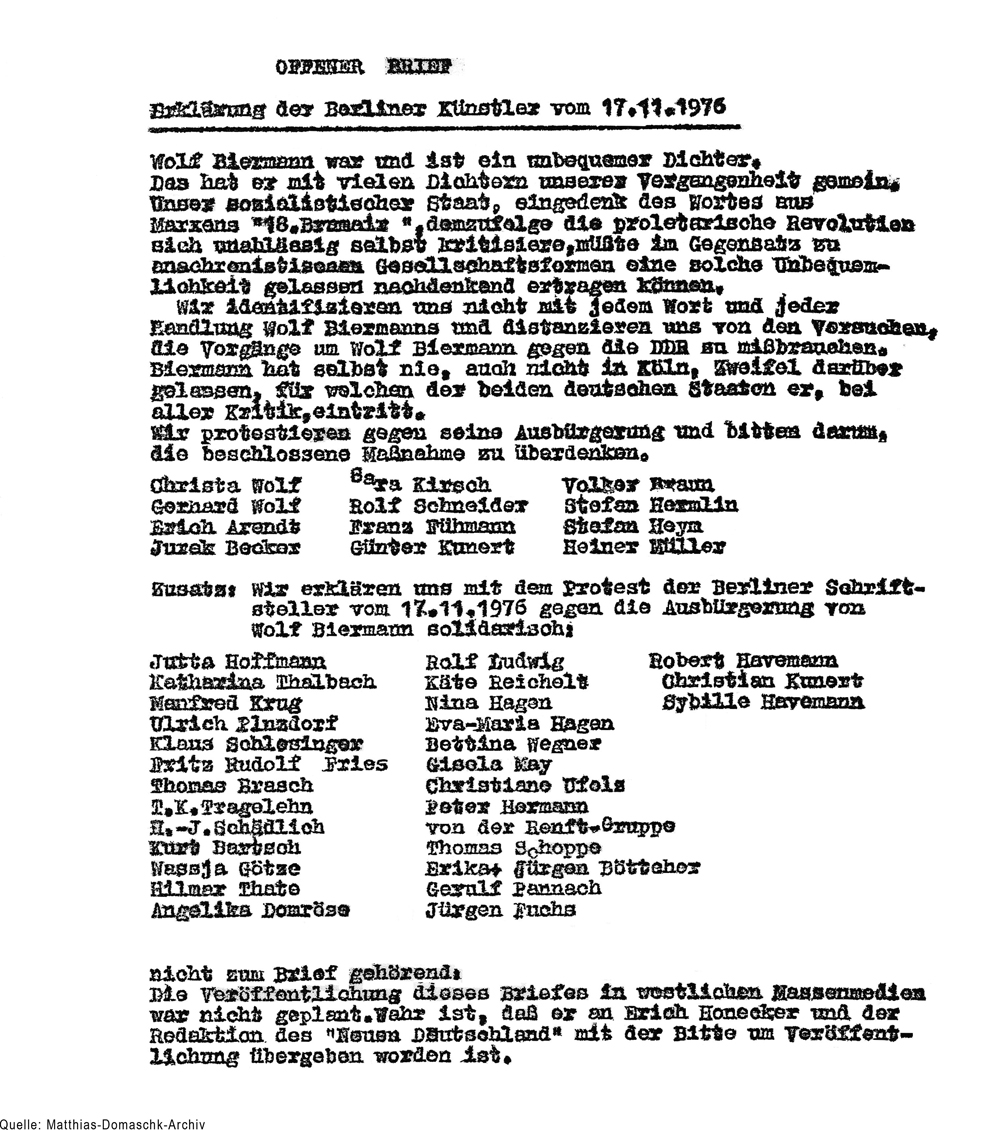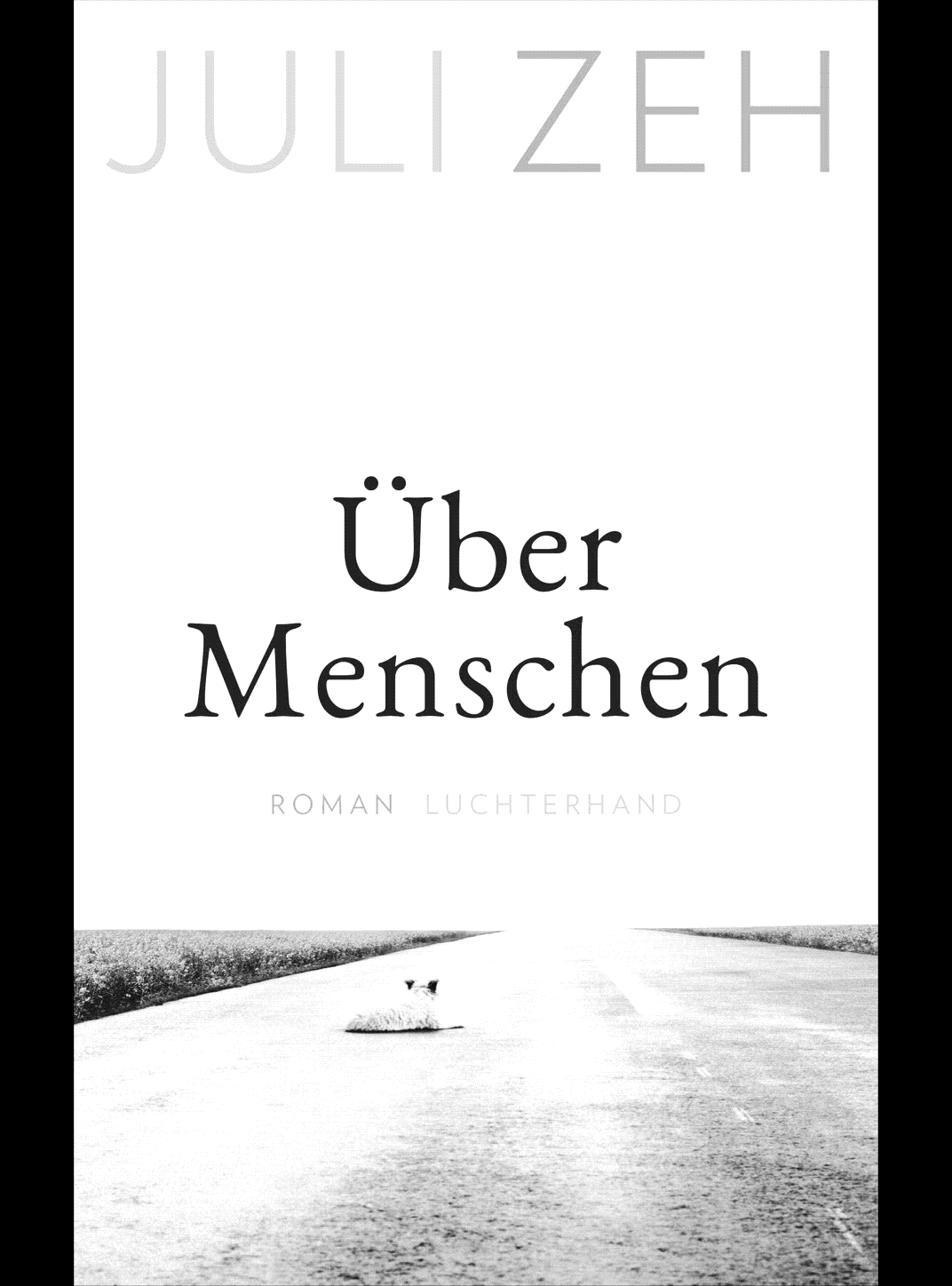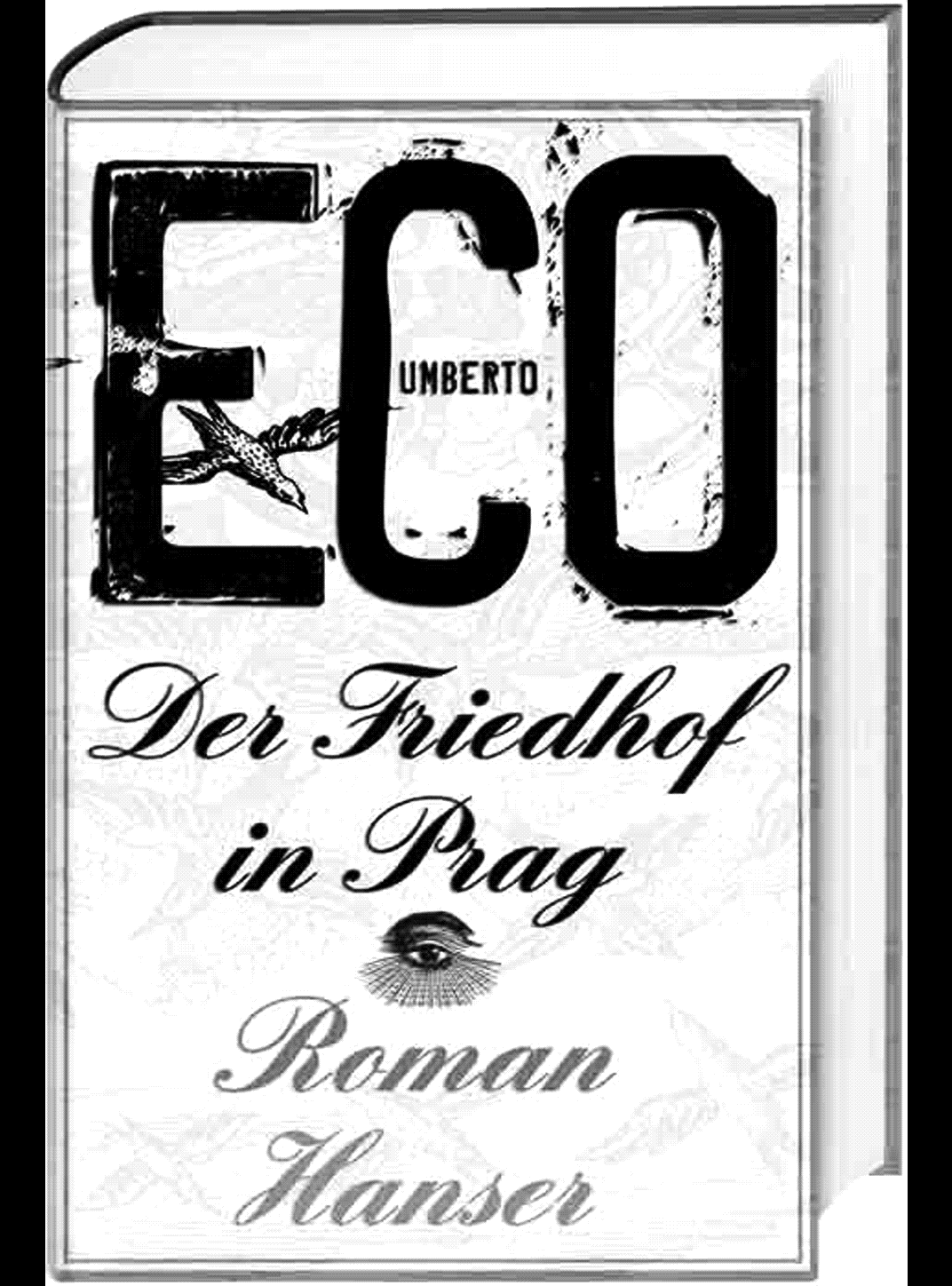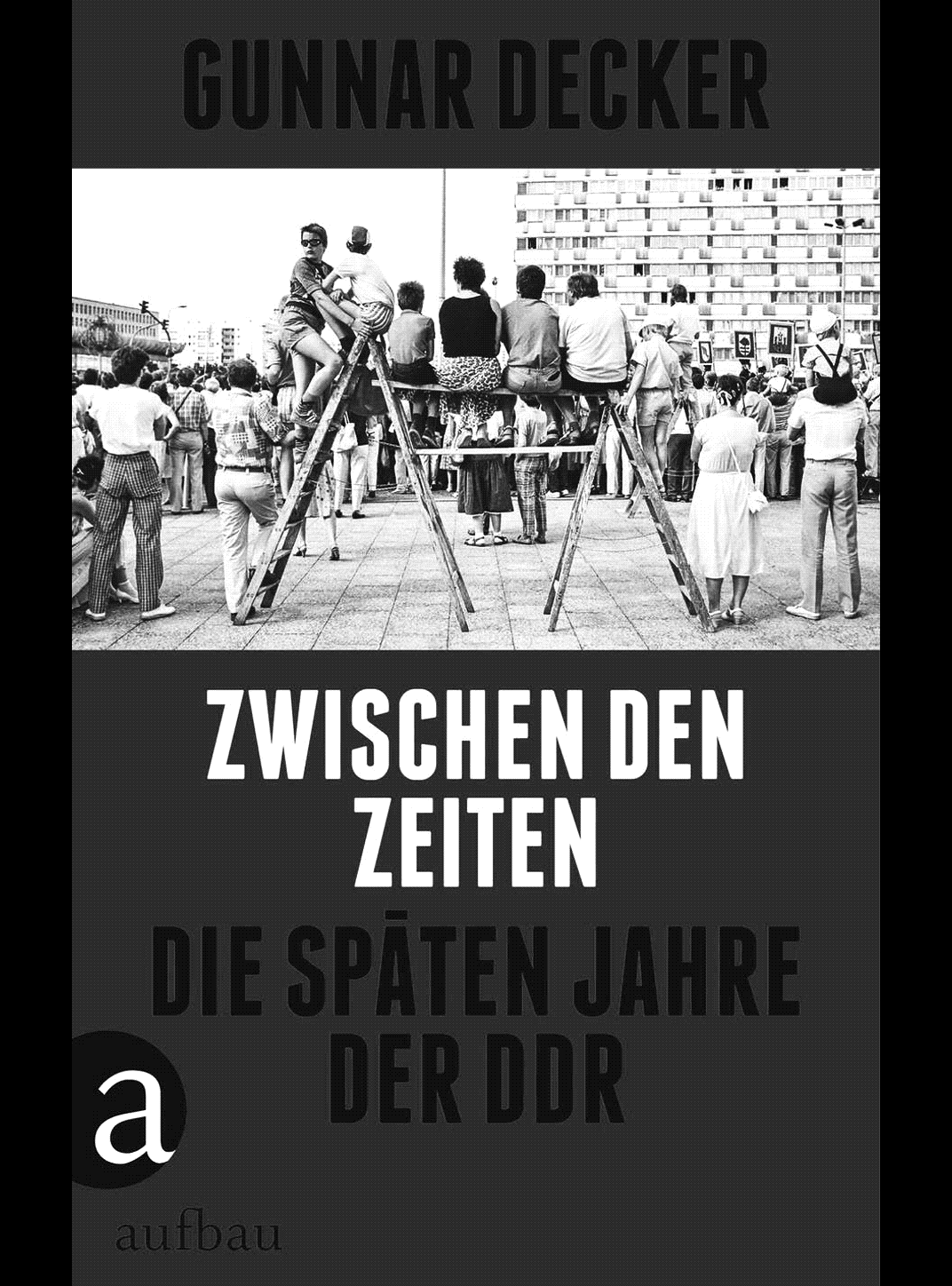Eine deutsche und eine sowjetische Familiengeschichte, beginnend im Berlin der späten 1920-er Jahre, endend in Wittenberge in den 2000-ern, also ganz fraglos eine Jahrhundertgeschichte.
Eine deutsche und eine sowjetische Familiengeschichte, beginnend im Berlin der späten 1920-er Jahre, endend in Wittenberge in den 2000-ern, also ganz fraglos eine Jahrhundertgeschichte.
Das Buch hat drei Teile, man könnte sie nennen: Deutschland, Sowjetunion, DDR/Deutschland
Teil eins: Deutschland
Die Geschichte: Ein Bauernjunge, Rainer Trutz, aus Vorpommern sieht für sich auf dem heimatlichen Hof keine Lebenschance (der ältere Bruder wird den Hof erben) und zieht nach Berlin, um dort Schriftsteller zu werden.
Nach vielen Entbehrungen kann er einen kleinen, leicht schlüpfrigen Roman veröffentlichen, doch zum Leben reicht das nicht, zumal der Verleger ihn über den Tisch zieht.
Ein zweiter Roman, es ist wohl kurz vor der Machtübernahme der Faschisten, wird anfangs wohlwollend in der Provinzpresse besprochen, jedoch in der rechten Presse verrissen (der Roman ist völlig unpolitisch und behandelt das Leben in einer deutschen Provinzstadt) In der Folge gibt es keine weiteren Rezensionen mehr (außer den politisch motivierten Verrissen)
Die Weltbühne meldet sich bei Trutz, ob er eine Rezension schreiben könne zu einem Reisebuch deutscher linker Schriftsteller durch die Sowjetunion. Trutz nimmt sofort an, schließlich kann die Weltbühne als intellektuelles Magazin ihm den Weg in die ernstzunehmende Literatenszene eröffnen. Allerdings erweist sich die Sache als schwierig: das zu rezensierende Buch ist voller blauäugiger Jubelgeschichten auf Stalin, Trutz sieht es sofort. Was soll er machen? Er hat zugesagt, kann aber nicht positiv rezensieren, weil das Buch eben Propaganda ist. Ablehnen kann er auch nicht, die Verlockung, als Weltbühne-Autor zu gelten, ist zu groß.
So schreibt er dann eine positive Rezension, die aber amüsiert durchblicken läßt, daß er die Autoren für naiv hält.
In der Zwischenzeit haben ihn die Nazis auf ihrer Liste, es wird bei ihm eingebrochen, die Polizei steht erkennbar auf Seiten der Nazis. Rainer und seine Frau Gudrun, eine engagierte Gewerkschafterin, beginnen um ihr Leben zu fürchten. Sie müssen raus aus Deutschland, doch nirgendwo bekommen sie ein Visum. Schließlich bekommen sie doch Visa für die Sowjetunion, das stand so nicht auf ihrem Plan, ist aber die einzige Möglichkeit, aus Deutschland rauszukommen.
Sie wandern nach Moskau aus, es ist 1933.
Teil zwei: Sowjetunion
Rainer hofft, als Redakteur oder ähnliches unterzukommen, aber das wird nichts, es gibt einfach zu viele ausgewanderte Schreiber. Und so muß er in einer Brigade arbeiten, die die Moskauer Metro mitbaut. Das ist harte Knochenarbeit, schlecht bezahlt, die Ausrüstung ist erbärmlich — aber er schafft das. Gudrun hat Arbeit in einer Schokoladenfabrik, ihr gefällt es dort, sie ist geachtet.
Schnell lernen beide, daß es ungeschriebene Regeln gibt, zuerst: Stalin ist ganz unzweifelhaft ein heiliges Genie, das darf unter keinen Umständen angezweifelt werden. Eine eigene Meinung wozu auch immer behält man im engsten Freundeskreis.
Sie bekommen ein Kind, einen Sohn, und nennen ihn Maykl. Sie sind jetzt integrierte Moskauer, haben sich an die sowjetischen Verhältnisse angepaßt.
Irgendwann lernen sie einen Professor der Lomonossow-Universität kennen, Waldemar Gejm, der sich mit Mnemotechniken beschäftigt. Er selber hat einen Sohn im Alter von Maykl, Rem, beide Kinder, sie sind etwa drei Jahre alt, befreunden sich. Gejm sammelt einen Kreis um sich, an dem er seine Mnemonik austestet. Hier kamen mir dann beim Lesen erste böse Vorahnungen auf: Zu dem Kreis gehören zwei Offiziere von Tuchatschewski und der Theaterregisseur Meyerhold. Man ahnt, daß das nicht gut ausgehen wird — und es geht nicht gut aus.
Meyerhold und die beiden Offiziere verschwinden. Es ist die Zeit der Moskauer Prozesse, des großen Terrors. Rainer wird die Rezension in der Weltbühne zum Verhängnis, er wird verhaftet und zu Zwangsarbeit in Workuta verurteilt. Gudrun und Maykl können ihn noch ganz kurz sehen bei Besteigen der Transportwaggons — dann ist er weg. Die Reise nach Workuta ist beschwerlich, die letzen paar Hundert Kilometer müssen die Häftlinge, entkräftet und unterernährt, zu Fuß zurücklegen. Gerade angekommen im Lager, wird Rainer sofort seiner paar Habseligkeiten beraubt und dann erschlagen.
Gudrun erfährt von alledem nichts, wird etwas später ebenfalls deportiert, nach Tscheljabinsk. Sie stirbt dort an Entkräftung.
In der Zwischenzeit wurde Waldemar Gejm ebenfalls verhaftet, er kommt ebenfalls nach Tscheljabinsk, zunächst als Lehrer. Die Jungs Maykl und Rem sehen sich wieder und sind überglücklich, einander zu haben. Doch nach Gudruns Tod ist Maykl Vollwaise, die Gejms nehmen ihn auf und stellen einen Antrag auf Adoption, von dem sie nie wieder etwas hören. Aber der Fleischwolf dreht weiter: Gejm verliert seine Lehrerstelle und muß in eine Holzfällerbrigade. Er stirbt dabei.
Mittlerweile ist der Krieg vorbei, alle hoffen, daß sie nun wieder in ihre Heimat zurück dürfen — doch nein, die Situation ändert sich nicht. Maykl wird nach Moskau in ein Waisenheim gesteckt. Dort ist er dank der Mnemotechniken von Waldemar Gejm ein ausgezeichneter Schüler. Es wird ihm angeboten, als Deutscher in die DDR auszureisen, was er nach einiger Überlegung annimmt. Zu seinem Freund Rem hat er keinen Kontakt mehr.
Teil drei: DDR/Deutschland
In Leipzig dann macht Maykl ein ausgezeichnetes Abitur und beginnt Geschichte zu studieren. Er ist ein sehr guter Student, allerdings nicht Mitglied der FDJ. Angesprochen darauf, erklärt er warum nicht: Der Kommunismus hat seinen Vater und seine Mutter umgebracht, er kann folglich kein Mitglied einer kommunistischen Organisation werden. Damit ist seine Karriere als Historiker erledigt. Er beendet sein Studium und studiert weiter Archivwissenschaft, bekommt eine Stelle, eine schöne Wohnung.
Eines Tages findet er in Archiven eindeutige Belege, daß ein Mitglied des Zentralkomitees der SED früher Mitglied bei NSDAP und SS war. Da Maykl das nicht unter den Tisch kehrt, wird er ins Goethearchiv nach Weimar strafversetzt — der Goethe ist so lange tot, da läßt sich nichts politisch gefährliches finden.
Dann kommt die Wende, und ein neuer Chef in Weimar: Maykl findet heraus, daß genau dieser seine Zwangsversetzung nach Weimar betrieben hatte. Jetzt, nach der Wende, will Maykl rehabilitiert werden und verklagt diesen Chef. Doch es gibt keine Akten mehr, die sind alle vernichtet, Maykl kann nichts beweisen und verliert den Prozeß.
Daraufhin wird er nach Wittenberge strafversetzt, in ein Provinzarchiv.
Dort wird er eines Tages von seinem Jugendfreund Rem besucht, nach 50 Jahren. Die beiden haben sich natürlich viel zu erzählen, Rem erzählt, daß er dem Leben seines Vaters hinterherforscht in russischen Archiven. Man beschließt, daß die Maykl und seine Frau Rem und seine Frau in Moskau besuchen werden.
Das Ende: Rem wird in seiner Moskauer Wohnung erschlagen, die Mörder nehmen die Computerfestplatte und alle schriftlichen Unterlagen mit.
Alle sind tot Rem, meine Eltern, Waldemar Gejm, Lilija, alle, nur ich nicht.
Damit endet das Buch.
Harter Stoff.
für mich ist der zweite Teil der beeindruckendste. Die stalinsche Mordmaschine, vor der es kein Entrinnen gibt. Es ist wie bei Orwells 1984: Nirgends gibt es Hoffnung, die Entwicklung kennt nur eine Richtung: die absolute Vernichtung jeder Menschlichkeit.
Hein schreibt sachlich, schnörkellos. Er selber bezeichnet sich als Chronisten, und das paßt. Gerade diese Sachlichkeit macht die Lektüre manchmal schmerzhaft, etwa wenn beschrieben wird, wie der 7‑jährige Maykl seine tote Mutter entdeckt und nicht weinen kann — er hat schon zu viele tote Menschen gesehen. Das sind Szenen, da kann man schon mal weinen oder das Buch aus der Hand legen, weil man nicht weiterlesen kann.
Der dritte Teil ist leider für mein Empfinden schwach geworden, den hätte ich mir auf die Länge eines Epilogs zusammengestrichen gewünscht.
Leseempfehlung? Schwierig. Für am Thema interessierte auf jeden Fall.
Ich finde die Erinnerung, daß der Stalinismus im eigenen Land Millionen eigener Bürger umgebracht hat, immer wieder erschreckend. Man weiß es ja, aber dennoch.
#ausgelesen
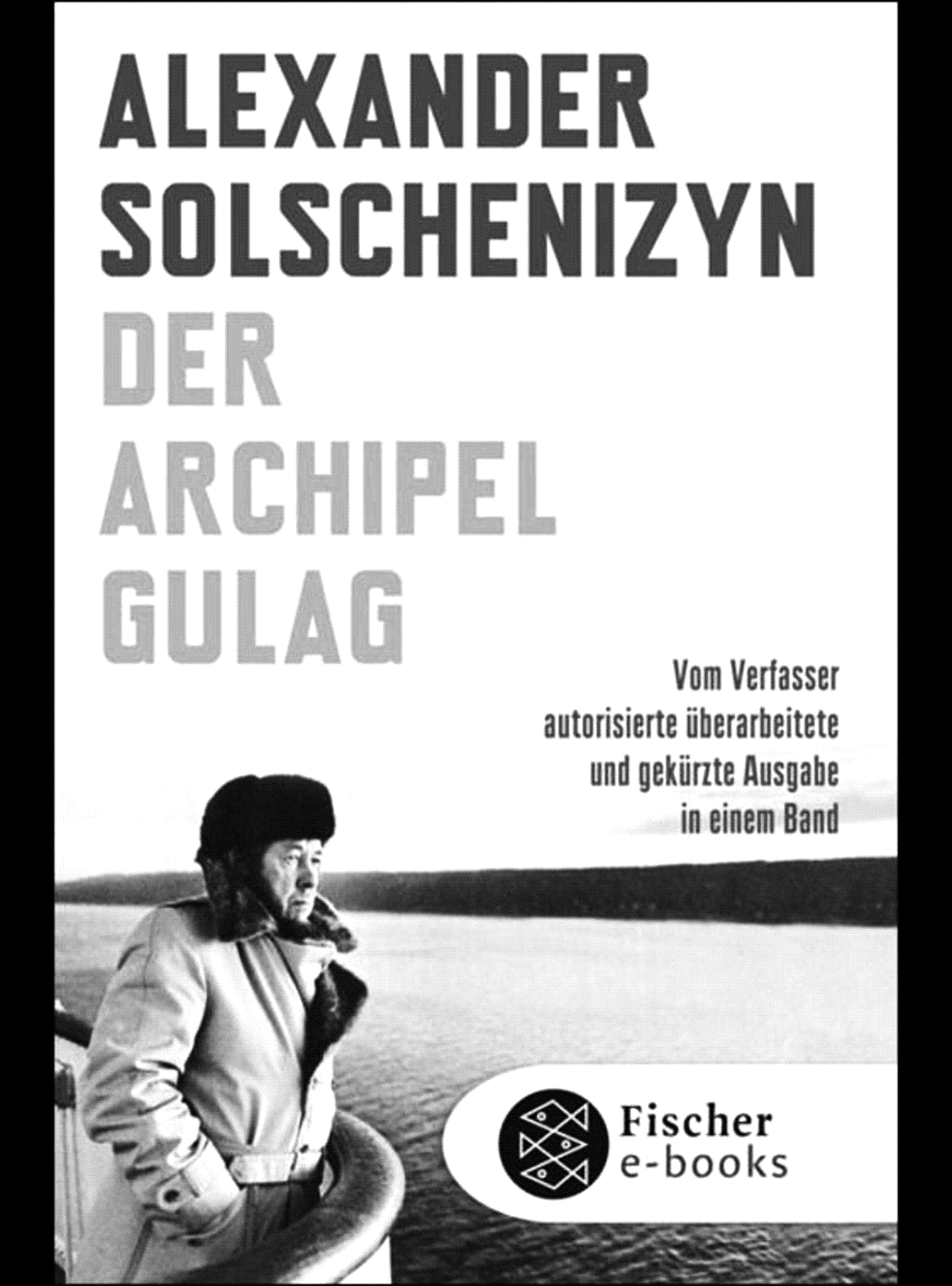 Es gibt Bücher, die kennt jeder, die hat kaum jemand gelesen. Der Archipel Gulag gehört zu diesen, Gulag geht flott vom Mund. Deshalb wollte ich das Buch einmal lesen. Es geht nichts über Primärquellen, und ein Tweet mit dem dem Screenshot eines Zeitungsartikels ist keine Primärquelle. Solschenizyn übrigens auch nur bedingt, dazu später.
Es gibt Bücher, die kennt jeder, die hat kaum jemand gelesen. Der Archipel Gulag gehört zu diesen, Gulag geht flott vom Mund. Deshalb wollte ich das Buch einmal lesen. Es geht nichts über Primärquellen, und ein Tweet mit dem dem Screenshot eines Zeitungsartikels ist keine Primärquelle. Solschenizyn übrigens auch nur bedingt, dazu später.